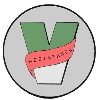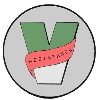|
Dass Männer und Frauen in unterschiedlicher Weise von kriegerischen
Auseinandersetzungen und Gewaltherrschaft betroffen sind, erleben wir in
diesen Tagen wieder einmal in ebenso eindrucksvoller wie erschreckender
Weise. Wieder einmal werden wir Zeugen davon, dass der Widerstand von
Frauen gegen ein totalitäres Regime, wie beispielsweise das der Taliban
in Afghanistan, ihnen damit keineswegs zwangsläufig ein Recht auf
Mitsprache und gleichberechtigte Teilhabe am Aufbau und der Entwicklung
der postdikatorischen Gesellschaft gibt. Wenn überhaupt, erscheinen sie
in der Berichterstattung als Opfer, nicht aber als in der Debatte über
die Zukunft des Landes ernstzunehmende Menschen mit gleichen Rechten.
Angesichts dieser Konstanten in der Geschichte und der weltpolitischen
Aktualität des Themas lag es denn auch nahe, dass Lucie Aubrac, die
große alte Dame der französischen Résistance, in der Eröffnung zur
Tagung “Die Frauen im Widerstand in Frankreich”, die vom 8. - 11.
Oktober in Berlin stattfand, auf die afghanischen Mädchen und Frauen und
ihren Widerstand, den Kampf um die elementaren Menschenrechte, das Recht
auf Bildung hinwies.
Im Banne der Zeitzeuginnen
Die unglaubliche Energie und Präsenz, mit der die fast 90jährige ihre
Überzeugungen vortrug, ließen etwas von der Kraft und dem Mut erahnen,
mit dem sie 1943 – sie war im sechsten Monat schwanger – ihren
Ehemann Raymond und andere Widerstandskämpfer in Lyon aus der
Gestapohaft befreite. Hätte es noch eines Beweises für die
Einzigartigkeit von Zeitzeugen als Quelle für die Geschichtsschreibung
bedurft, er wäre spätestens bei dieser Gelegenheit erbracht worden. Die
Anwesenheit der Frauen, ihre unprätentiösen und zugleich packenden
Erzählungen machten die Tagung zu einem besonderen Ereignis.
Sehr zu recht wies Lucie Aubrac darauf hin, dass diese Tagung genau zum
richtigen Zeitpunkt und am richtigen Ort stattfand. Nicht zu früh – denn
vor der deutschen Wiedervereinigung wäre die gemeinsame Sicht auf dieses
Kapitel deutsch-französischer Geschichte wohl an der gespaltenen
innerdeutschen Geschichtssicht gescheitert – und nicht zu spät,
insofern als die letzten Überlebenden in der neuen Hauptstadt
Deutschlands symbolisch für die vielen Opfer empfangen und geehrt
wurden.
Rosette Peschaud über die “Rochambelles”
Die verschiedenen Berichte und Zeugnisse der ehemaligen
Widerstandskämpferinnen stellten denn auch die eindeutigen Höhepunkte
der Tagung dar. So beispielsweise der mit zahlreichen Anekdoten und
augenzwinkerndem Humor angereicherte Bericht von Rosette Peschaud, die
zusammen mit an-deren Frauen die französischen Streitkräfte in
Nordafrika und auch später in Deutschland unterstützte.
Diese weithin unbekannte weibliche Hilfstruppe der “Rochambelles”, die
in spezifischen Funktionen (z.B. als Fahrerinnen und Sanitäterinnen)
tätig waren, leiteten ihren Namen vom französischen Generalleutnant
Rochambeau ab, der im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg auf Seiten
der Nordstaaten in Nordamerika siegreich mitkämpfte. Die Finanzen für
das spektakuläre Unternehmen stammten von einer reichen Amerikanerin,
die den nicht immer begeisterten französischen Generalstab mit ihrem
großzügigen Hilfsangebot von Fahrzeugen und engagierten Frauen
überraschte.
Wie ungewöhnlich und wenig bekannt dieser As-pekt der
militärischen Beteiligung von Frauen auf dem Schlachtfeld ist, ließ
sich an der Reaktion Lucie Aubracs ablesen, der man die
Ergriffenheit über den Mut und das Schicksal der bisher wenig
beachteten Frauen anmerkte.
Marie-Jo Chambart de Lauwe über Ravensbrück
Die gleiche Eindringlichkeit vermittelte auch der Bericht von Marie-Jo
Chambart de Lauwe, die als Deportierte und Überlebende von Ravensbrück
stellvertretend für ihre Leidensgenossinnen ein Bild vom Leben der
Frauen im KZ zu vermitteln suchte.
Zur wissenschaftlichen Ausbeute
Während also die Begegnung mit den Zeitzeuginnen und ihrer Geschichte
die Vergangenheit lebendig werden ließ, blieben die wissenschaftliche
Ergebnisse, die man sich von diesem ersten deutsch-französischen
Kolloquium zum Thema erwarten konnte, hinter den Erwartungen zurück.
Der deutscher Part
Angesichts der zahlreich angereisten renommierten französischen
Historikerkollegen hätte die Tagung ein Meilenstein im Austausch
zwischen deutschen und französischen Wissenschaftlern werden können.
Dass es nicht dazu kam, mag zum einen daran liegen, dass die Kollegen
der Berliner Hochschulen, die sich theoretisch für Zeitgeschichte und
Fragen der Geschlechterforschung interessieren, durch Abwesenheit
glänzten. Vom Zentrum für interdisziplinäre Frauen- und
Geschlechterforschung der Technischen Universität schaute lediglich
Karin Hausen kurz vorbei und moderierte die Tagung einen Vormittag lang.
Die vorgetragenen Ergebnisse wiederum brachten kaum neue Erkenntnisse
ans Tageslicht, sondern beschränkten sich auf die Wiederholung von
bereits Bekanntem.
Der französische Part
Einige französische Forscher versuchten, an der bisher gültigen These
von der Vernachlässigung der Frauen als Forschungsgegenstand des
Widerstands zu rütteln, in dem sie auf die nach dem Krieg erschienenen,
von Frauen verfassten autobiographischen Berichte hinwiesen und einzelne
Zitate vorbrachten, in denen von der Bedeutung der Frauen im Widerstand
die Rede war. Das Vorhandensein von Quellen und Zeugnissen von und über
Frauen belegt ja aber noch lange nicht, dass diese von den Historikern
auch tatsächlich zur Rekonstruktion der Geschichte herangezogen wurden.
Ein Blick in Geschichtsbücher und auf Denkmäler genügt jedenfalls, um
die Abwesenheit der Frauen in der allgemeinen Erinnerungskultur zu
konstatieren.
Mangel an neuen Perspektiven der Forschung
Der Mangel an wirklich neuen “Perspektiven der Widerstandsforschung”
zeigte sich auch in den Beiträgen über jüdische und deutsche Frauen im
Widerstand in Frankreich, in denen Bekanntes wiederholt oder gar am
Thema vorbeigeredet wurde. Angesichts des Forschungsstands über die
Spezifik des Exils und des Widerstands jüdischer Frauen in Frankreich
davon zu sprechen, dass es unsinnig sei, sich dieser Frage überhaupt zu
widmen, mutet schon merkwürdig an, vor allem, wenn diese Kritik aus dem
Mund der Referentin selbst kommt. Der gleiche Mangel an Interesse am
eigentlichen Thema schien sich der Referentin zum Widerstand der
deutschen Frauen in Frankreich bemächtigt zu haben, die viel über das
deutsche Exil im allgemeinen und wenig über die Spezifik des Widerstands
deutscher bzw. deutschsprachiger Frauen in Frankreich zu sagen wußte.
Die Unterschätzung der Kategorie Geschlecht in der Forschung
Dass die Chance zur wissenschaftlichen Vertiefung der Frage des
Widerstands von Frauen vertan wurde, lag unter anderem daran, dass die
Bedeutung der Kategorie Geschlecht zur Erforschung des Widerstands in
Frankreich (und dies betrifft Männer und Frauen) lediglich von der
amerikanischen Forscherin Paula Schwartz ernst genommen und entwickelt
wurde. Unter den TagungsteilnehmerInnen stießen die dabei aufgeworfenen
Fragen erstaunlicherweise auf Unverständnis bis Abwehr.
Dabei zeigte sich doch an einigen wenigen Beispielen und Vorträgen, wie
wichtig diese Kategorie bei der Entwicklung neuer Fragestellungen und
zum Verständnis des Geschehenen nötig ist. Solange der Widerstand
beispielsweise an ein ganz bestimmtes, militärisches und an männliche
Erfahrungswelten orientiertes Verständnis gekoppelt war, traten
spezifische Aktionen wie z.B. die auf der Tagung vorgestellten
Demonstrationen von Hausfrauen und die Untergrundzeitschriften von
Frauen gar nicht erst ins Blickfeld der Forschung. Zum genaueren
Verständnis dieser Sachverhalte und bei der wissenschaftlichen Analyse
müssen immer auch die an das Geschlecht gebundenen Zuschreibungen
berücksichtigt werden. Erst dann wird manches, was zunächst als
Ungereimtheit erscheint, erklärbar. Warum beispielsweise werden Frauen,
die politisch aktiv sind und als solche verhaftet und interniert werden,
unterschwellig oder auch ganz explizit als Prostituierte bezeichnet?
Warum wurden Frauen, die im Widerstand waren, häufig auch nach dem Krieg
als Prostituierte angesehen? Solche Fragen können nur beantwortet
werden, wenn man die geschlechtsspezifischen Rollenklischees und ihre
Funktionsweisen analysiert.
Unterschiede Deutschland-Frankreich
Ein bisschen spannend wurde es dann noch einmal gegen Ende der Tagung,
als es um Erinnerungsdiskurse und Erinnerungsarbeit ging. Der
vergleichende Blick von Florence Hervé auf den Widerstand in Deutschland
und Frankreich brachte einige Unterschiede zu Tage, die zu vertiefen und
genauer zu betrachten sicher lohnenswert ist und die auch angeregt und
kontrovers diskutiert wurden.
Spezifik der Erinnerungsarbeit
Einen sehr aufschlussreichen Beitrag lieferte die junge Forscherin
Sandra Fayolle, die Form und Funktion von Erinnerungsprozessen am
Beispiel der französischen Widerstandskämpferin Danielle Casanova
untersucht hat. Ihr Beitrag machte die Mechanismen der
Erinnerungsarbeit, ihre geschlechtspezifische Prägung und
institutionelle, sprich: parteipolitische Einbindungen deutlich.
Auch wenn es ansonsten in den drei Tagen nicht immer zu geistigen
Höhenflügen und neuen Erkenntnissen kam, so verlief die Tagung aufgrund
der ausgezeichneten Organisation durch die Mitarbeiter der Gedenkstätte
Deutscher Widerstand insgesamt in einer sehr angenehmen Atmosphäre. Sie
hatten dafür gesorgt, dass die Veranstaltung in einer dem Thema und den
angereisten Zeitzeugen entsprechenden Rahmen stattfand. Die gemeinsame
Besichtigung der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück mit den
Zeitzeuginnen bildete einen angemessenen und würdigen Abschluß der
Tagung.
|